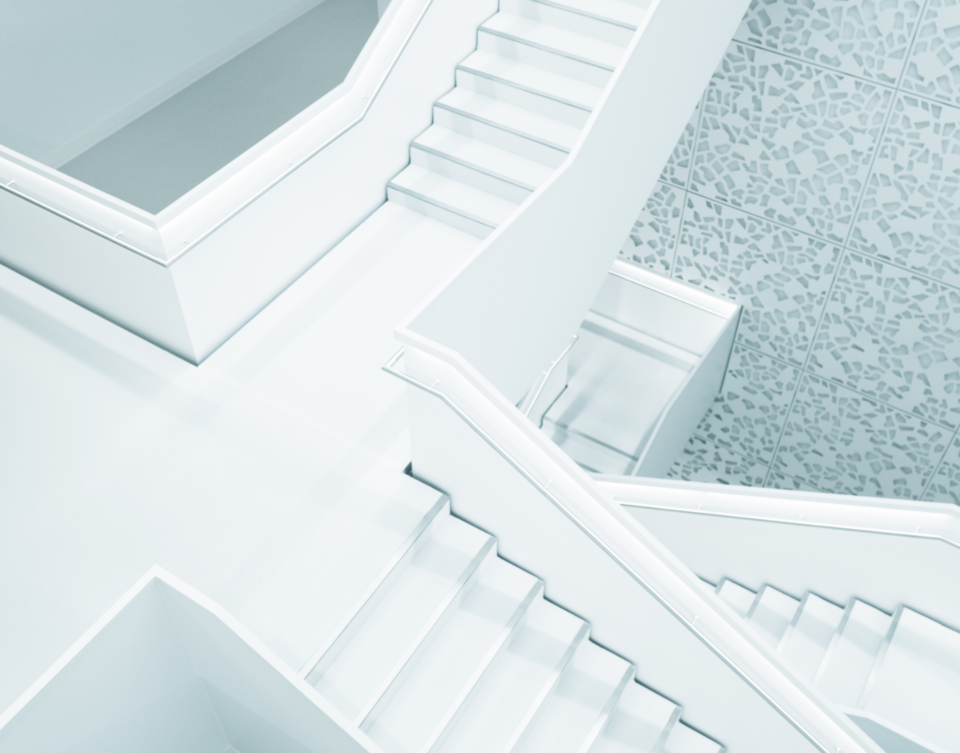Wie entwickelt sich Governance im Zuge der technologischen Beschleunigung?
Die Technische Universität München (TUM) und das Rechtsstaatsprogramm Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS RLPA), TUM Asia und der TUM Think Tank haben am 20. Februar 2025 in Singapur die Veranstaltung „Frontier Technologies - Governance Frontiers“ ausgerichtet. Diese Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste kamen, bot eine interaktive Plattform, um zu untersuchen, wie generative KI und Quantentechnologien das Regieren neu gestalten. Die Teilnehmer untersuchten kritische Governance-Herausforderungen und das Potenzial dieser aufkommenden Technologien, transformative Innovationen im öffentlichen Sektor voranzutreiben.
Generative KI verändert die Governance. Quantencomputing definiert Sicherheit neu. Diese Technologien entwickeln sich in einem Tempo, das selbst die agilsten Regulierungsmechanismen herausfordert. Während sie beispiellose Chancen bieten – von der Effizienzsteigerung in der öffentlichen Verwaltung über verbesserte Entscheidungsfindung bis hin zur Revolutionierung der Datensicherheit – bringen sie auch komplexe Dilemmata mit sich. Wer legt die Regeln fest? Wie stellen wir Verantwortlichkeit sicher? Und können Governance-Rahmen mit dem technologischen Wandel Schritt halten?
Beim Workshop Frontier Technologies – Governance Frontiers in Singapur, der gemeinsam von der Technischen Universität München (TUM), der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), TUM Asia und dem TUM Think Tank ausgerichtet wurde, standen genau diese Fragen im Mittelpunkt. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kamen zusammen, um über die Governance-Grenzen von KI und Quantentechnologien zu diskutieren – nicht als abstrakte Zukunftsthemen, sondern als akute Herausforderungen, die Politik und Gesellschaft bereits heute prägen.
Die Diskussionen machten eines deutlich: Governance ist kein statisches Rahmenwerk – sie ist ein sich entwickelnder Prozess, der sich dem technologischen Wandel anpassen muss. Weltweit entstehen unterschiedliche Governance-Modelle mit jeweils eigenen Auswirkungen. Der „Brussels Effect“ beschreibt, wie strenge EU-Vorschriften globale Standards prägen und klare rechtliche Leitplanken für KI und digitale Governance setzen. Der „Silicon Valley Effect“ verfolgt einen anderen Ansatz, bei dem Selbstregulierung und marktorientierte Innovation im Vordergrund stehen. Der „Beijing Effect“ hingegen repräsentiert ein staatlich gelenktes Modell, bei dem zentrale Aufsicht eine dominierende Rolle spielt. Diese Paradigmen umreißen die zentrale Herausforderung: Wie lassen sich Zukunftstechnologien auf eine Weise steuern, die wirksam, ethisch vertretbar und global kohärent ist?
Generative KI
Im Bereich der generativen KI beginnen Regierungen damit, KI-gestützte Lösungen in die öffentliche Verwaltung zu integrieren – doch Bedenken hinsichtlich Voreingenommenheit, Verantwortlichkeit und regulatorischer Zersplitterung bleiben bestehen. Singapurs National AI Strategy, die erstmals 2019 vorgestellt und kürzlich überarbeitet wurde, spiegelt einen Ansatz wider, der versucht, Innovation mit Schutzmechanismen in Einklang zu bringen. Das AI Verify Toolkit, eine Open-Source-Plattform, hat sich als zentrale Initiative etabliert – sie ermöglicht es Unternehmen und Regulierungsbehörden, KI-Systeme im Hinblick auf die Einhaltung ethischer und regulatorischer Standards zu bewerten. Doch ist freiwillige Governance ausreichend? Die Debatte dauert an – zwischen jenen, die brancheneigene Leitlinien befürworten, und denen, die gesetzliche Regelungen fordern. Während Singapur zu einem hybriden Ansatz tendiert – der freiwillige Umsetzung fördert und gleichzeitig einen Fahrplan für künftige Regulierung vorsieht – verfolgt der AI Act der EU einen stärker vorschreibenden Ansatz, bei dem von Anfang an strenge Vorgaben durchgesetzt werden.
Über die Regulierung hinaus wirft KI auch Fragen zu digitalem Vertrauen und kultureller Repräsentation auf. Große KI-Modelle werden überwiegend mit westlich geprägten Datensätzen trainiert, was das Risiko birgt, sprachliche und kulturelle Vielfalt zu marginalisieren. Singapur begegnet dem, indem es in KI-Projekte investiert, die Dialekte bewahren und sicherstellen sollen, dass nationale Identität in KI-Anwendungen verankert ist. Dies verweist auf ein größeres Problem: Wenn KI die Funktionsweise von Gesellschaften prägt – wer definiert dann ihre Werte?
Quantentechnologie
Quantentechnologie stellt eine völlig neue Herausforderung für die Governance dar. Obwohl sie sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, birgt Quantencomputing das Potenzial, Verschlüsselung, Sicherheit und geopolitische Machtstrukturen grundlegend zu verändern. Singapurs National Quantum-Safe Network (NQSN) dient als Testumgebung für Quantenverschlüsselung und nutzt die zentral verwaltete Glasfaserinfrastruktur des Landes, um mit quantensicheren Kommunikationsstandards zu experimentieren. Doch Governance darf nicht auf nationaler Ebene enden. Das Rennen um die Quantum Supremacy – angetrieben durch die USA, China und die EU – wirft dringliche Fragen zur internationalen Zusammenarbeit auf. Sollten Institutionen wie die Vereinten Nationen oder die Welthandelsorganisation eine Rolle bei der Festlegung von Governance-Rahmen für Quantentechnologien spielen? Oder werden fragmentierte nationale Strategien dominieren, die regulatorische Inkonsistenzen schaffen und dadurch die globale Sicherheit gefährden könnten?
Während sich KI und Quantencomputing weiterentwickeln, muss Governance proaktiv, inklusiv und vorausschauend bleiben. Der Workshop betonte die Notwendigkeit regionenübergreifender Zusammenarbeit und interdisziplinären Engagements – um sicherzustellen, dass Governance-Innovation nicht bloß eine Reaktion auf technologischen Wandel ist, sondern eine aktive Kraft zur Gestaltung einer nachhaltigen, demokratischen und gerechten Zukunft.