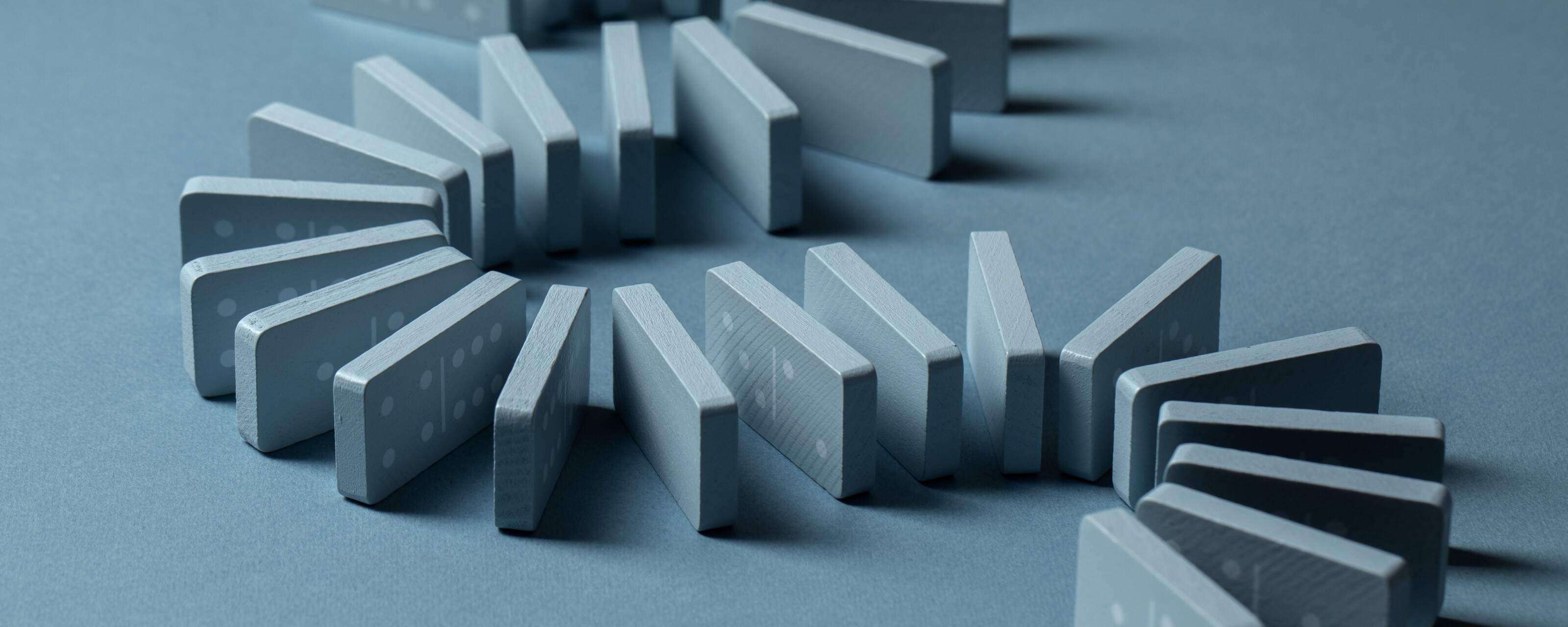Nach dem Web – das Mesh: WAP, MCP und agentische Architekturen
Notiz 3 aus dem Forschungsjournal von Nicklas Lundblad: Gedanken und Fragen zu Agenten, Agency und Institutionen
Notiz 3
Der Wireless Application Protocol, kurz WAP, wurde Ende der 1990er Jahre entwickelt, um etwas wie das Internet auf Mobiltelefone zu bringen. Damals hatten Handys winzige monochrome Displays, keine Touchscreens und waren über langsame, unzuverlässige Netzwerke verbunden. Das Web selbst war für Desktop-Computer konzipiert – mit Browsern, die HTML, Bilder und Multimedia interpretieren konnten, also weit mehr, als ein Telefon bewältigen konnte.
Um dieses Problem zu lösen, gründeten große Telekommunikationsunternehmen wie Nokia, Ericsson und Motorola 1997 das WAP Forum (die Seite wapforum.org leitet heute auf ein Standardisierungsportal weiter). Ihr Ziel war, eine leichtere Version des Webs zu schaffen – mit einer eigenen Markup-Sprache (WML, Wireless Markup Language) und einem eigenen Übertragungsprotokoll (WSP statt HTTP) –, damit Mobilgeräte effizient Informationen abrufen und darstellen konnten. Die Vision: Jeder Mensch, überall, sollte das Internet über sein Telefon nutzen können.
In der Praxis scheiterte WAP schnell. Verbindungen waren langsam, Seiten ohne Grafiken und Farbe, und jede Anfrage kostete Zeit und Geld. Die Nutzererfahrung hatte kaum etwas mit dem echten Internet gemein – es war eher ein textbasiertes Verzeichnis vereinfachter Seiten. Entwickler ärgerten sich über den Aufwand, separate WML-Seiten zu erstellen, und Nutzer empfanden den Dienst als unbeholfen und teuer. Mitte der 2000er waren Mobilgeräte schließlich leistungsfähig genug, um echtes HTML darzustellen, und mobile Datennetze deutlich besser. Als das iPhone 2007 mit einem vollwertigen Browser auf den Markt kam, war WAP praktisch über Nacht überholt. Wenige Jahre später war es verschwunden – eine mutige, aber kurzlebige Brückentechnologie für eine Welt, die noch nicht bereit war.
Das Model Context Protocol (MCP), eingeführt 2024 von Anthropic, verfolgt ein ähnliches Ziel – diesmal für KI-Agenten. Die digitale Welt ist bisher für Menschen gebaut: APIs, Datenbanken, Webanwendungen – sie sind für Entwickler und Endnutzer gedacht, nicht für autonome Modelle, die planen, schlussfolgern und handeln. MCP sollte diese Lücke schließen: ein standardisiertes Protokoll, das Agenten erlaubt, sich in solche Systeme „einzuklinken“, ihre Funktionen zu erkennen und sie über eine einheitliche Schnittstelle sicher aufzurufen. Das Protokoll basiert auf JSON und läuft über bekannte Transportmechanismen wie HTTP oder Standard-I/O, sodass Entwickler bestehende Systeme – etwa Kalender, Tabellen oder Slack-Kanäle – als MCP-Tools „einpacken“ können.
Das Ziel war also dasselbe wie bei WAP: einer neuen Entität – damals Mobiltelefonen, heute KI-Agenten – den Zugang zu einer Infrastruktur zu ermöglichen, die für eine frühere technologische Generation gebaut wurde. So wie WAP das Web auf frühen Handys „zum Laufen brachte“, macht MCP die Softwarewelt für frühe Agenten nutzbar. Und ebenso legt es die Bruchstellen dieser Übersetzung offen: Agenten müssen menschliche Entwickler imitieren, API-Aufrufe formulieren und strukturierte Antworten deuten, anstatt sich wirklich nativ in digitale Umgebungen einzufügen. Im Moment ist MCP ein notwendiges Gerüst – es ermöglicht das Funktionieren eines entstehenden Agenten-Ökosystems in einer fragmentierten technischen Landschaft. Doch wenn sich das Muster wiederholt, wird MCP verschwinden, sobald Systeme „agent-native“ werden: wenn Daten, Anwendungen und Umgebungen direkt mit intelligenten Modellen kommunizieren, ohne Zwischenschicht.
In diesem Sinne steht MCP zu Agenten wie WAP einst zu Mobiltelefonen: eine notwendige Brücke in eine neue Welt, die überflüssig wird, sobald das neue Medium gelernt hat, selbstständig zu gehen.
Die eigentliche Veränderung wird also erst dann eintreten, wenn wir beginnen, das Web für Agenten zu bauen. Was das genau bedeutet, ist allerdings schwer zu erfassen – und möglicherweise tiefgreifend transformativ. Unsere Kinder werden sich vermutlich köstlich darüber amüsieren, wenn wir ihnen erzählen, dass wir einst „Browser“ hatten und „im Internet surften“. In einem möglichen Zukunftsszenario wird es nämlich weder Browser noch ein „Web“ im klassischen Sinn geben – sondern nur eine Vielzahl von Ressourcen, die Agenten in Echtzeit zu nützlichen, kombinierten Schnittstellen und Diensten zusammenstellen. Agenten haben keinen Grund, in „Seiten“ oder „Websites“ zu denken – oder in irgendeiner der Metaphern, mit denen wir die Technologie bisher überformt haben.
Warum ist das relevant für unser Forschungsprojekt hier am TUM Think Tank? Weil die Art und Weise, wie dieses zukünftige Netz von Ressourcen aufgebaut wird, davon abhängen könnte, wie wir Agency und Agenten verstehen. Wir müssen uns also fragen, welche Arten von Agenten es gibt – und auf welche wir uns konzentrieren sollten, wenn wir neue Netzwerkschichten für sie gestalten.
Der Begriff Agent wird heute für nahezu alles verwendet. Wie Brinnae Bent in ihrem aktuellen Paper „The Term ‘Agent’ Has Been Diluted Beyond Utility and Requires Redefinition“ (2025) zeigt, ist das Wort so stark verwässert, dass es kaum noch analytischen Nutzen hat. Sie schlägt daher eine Neudefinition mit drei Grundanforderungen vor. Etwas darf nur dann als Agent bezeichnet werden, wenn es:
- … einen messbaren Einfluss auf seine Umgebung hat
- … zielgerichtetes Verhalten zeigt, und
- … eine Form von Zustandsbewusstsein besitzt
Wenn diese Kriterien erfüllt sind, kann man Agenten entlang verschiedener Dimensionen kategorisieren. Aus ihrem Paper:

Bents Arbeit erinnert an frühere taxonomische Ansätze von Atoosa Kasirzadeh und Iason Gabriel, die Agenten im Kontext von Alignment-Fragen einzuordnen versuchten. Es existieren viele solcher Taxonomien – doch was wäre, wenn wir eine Klassifikation entwickeln würden, die sich nicht auf Alignment, sondern auf die Organisation vernetzter Ressourcen bezieht?
Wie würden wir Agenten charakterisieren, wenn das Ziel darin bestünde, das Web für Agenten neu zu entwerfen?Vermutlich wäre das Ergebnis kein „Web“ mehr, sondern etwas, das man besser als „Capability Mesh“ – oder kurz Mesh – bezeichnen könnte.
In diesem Mesh würden Agenten auf Ressourcen zugreifen, um Aufgaben unterschiedlicher Art und Dauer zu lösen, und zugleich eigene Fähigkeiten als Ressourcen in dieses Netz einspeisen.
Wenn wir speziell darüber nachdenken, welche Art von Taxonomie für die Architektur eines solchen Mesh hilfreich wäre, dann könnte sich daraus ein ganz neues Ordnungsprinzip ergeben – eines, das sich nicht an Seiten, Servern oder Protokollen orientiert, sondern an Fähigkeiten, Kontexten und Handlungsrelationen zwischen Agenten.
Oder, in einer Tabelle: